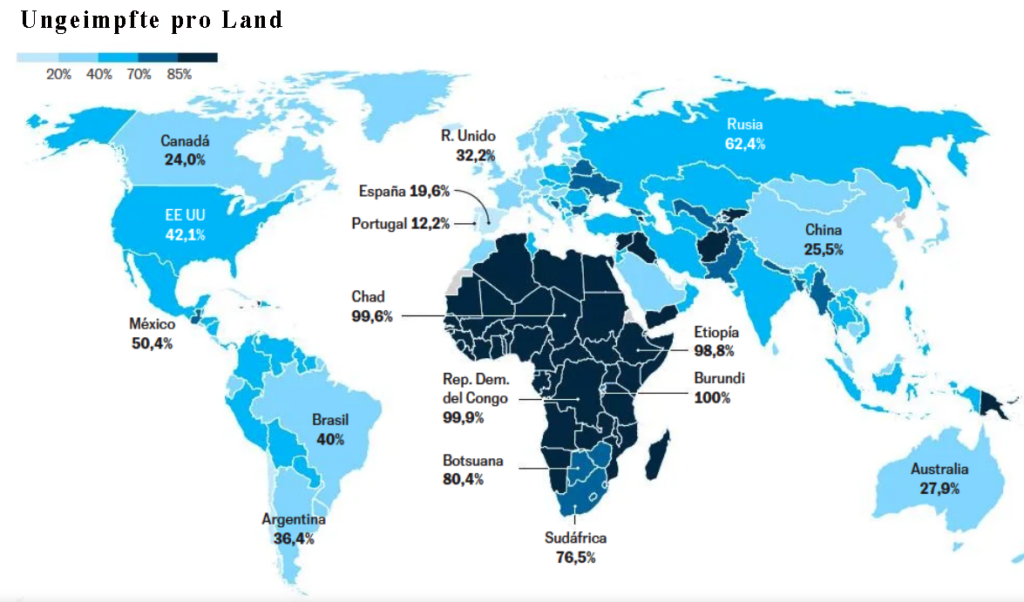„DER TEURE RUSSISCHE PLAN GEGEN DIE WIRTSCHAFTSSANKTIONEN
Als Reaktion auf die Sanktionen nahm die russische Regierung 2014 einen ehrgeizigen Wirtschaftsplan in Angriff, um die die Importe durch einheimische Produktion zu ersetzen.“
So etwas hat die Freie Welt gar nicht gerne.
Der Rest des Globus hat sich als Markt für ihre Produkte zu bewähren, weil irgendwohin muß sie ihren Krempel ja exportieren. Es war also ein sehr schlechtes Benehmen Rußlands, sich diesem Anspruch entziehen zu wollen. Die Annexion der Krim ist dagegen ein Klacks. Es war ja schon eines der Verbrechen der Sowjetunion, sich nicht in gebührender Weise in den Weltmarkt zu integrieren.
Rußland hat nach der Wende alles brav so gemacht, wie es die Heimatländer der Marktwirtschaft und der Menschenrechte forderten und nach wie vor fordern: Es hat seine Währung konvertibel gemacht und sich fest bei westlichen Banken verschuldet, um die Importe, die in großer Zahl hereinströmten, auch zahlen zu können.
Diese idyllischen Zustände sind als Reaktion auf die Sanktionen jetzt gefährdet. Der ganze folgende Artikel ist von dem Ärger über diese gar nicht marktkonforme Verhalten erfüllt.
„Die Bestrafung derjenigen Personen, die in diesem Jahr (2014) an der Einverleibung der Krim beteiligt waren, durch die EU und die USA“ (Reihenfolge!) „wurde vom Kreml durch ein vollständiges Einfuhrverbot für Lebensmittel aus dem Westen beantwortet.“
Der „Westen“ sind hier eindeutig USA und EU, Rußland war es wichtig, das klarzustellen. Israel oder die Schweiz fielen nicht unter das Einfuhrverbot.
„In den folgenden Jahren verlängerte sich die Liste der Sanktionen, wegen Repression und Einmischung in die Wahlen, in in gleichem Maße verstärkten sich die mehr oder weniger erfolgreichen Bemühungen um Waren »Made in Russia«.
Der Befehl, Importwaren durch russische Erzeugnisse zu ersetzen, trifft alle auch nur vorstellbaren Bereiche. Das Industrieministerium richtete ein Internet-Portal ein, in dem alle geplanten Ersatzproduktionen aufgelistet sind, von der Schwerindustrie über Medikamente bis zum alltäglichen Konsum. So ist zum Beispiel vorgesehen, Kinderkleidung von einer Importquote von 85% 2016 auf 65% 2021 zu verringern, und gleichzeitig die Bremsscheiben für Autos von 60% auf 20%.“
Diese Artikel werden aber gar nicht aus der EU oder den USA geliefert, sondern aus China, der Türkei oder anderen asiatischen Staaten. D.h., das Importsubstitutionsprogramm bezieht sich auf ALLE Waren und hat neben der Verringerung von unerwünschten Abhängigkeiten auch die Verbesserung der Zahlungsbilanz und eine Verringerung der Auslandsverschuldung im Auge.
„Auf manchen Gebieten wurden tatsächlich bemerkenswerte Fortschritte erzielt.“
Bei diesem gönnerhaften Tonfall muß man sich erst einmal zurückerinnern, wie es eigentlich zu dieser Importabhängigkeit gekommen ist. In sowjetischen Zeiten wurde relativ wenig importiert, weil Devisen knapp waren. Kaffee und Bananen waren deshalb Mangelware, weil die auf dem Gebiet der SU und ihrer Satellitenstaaten nicht wuchsen. Bei Technologie waren die Staaten des Warschauer Paktes Verboten unterworfen, die auf den COCOM-Listen angeführt waren – sie KONNTEN sie also nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten kaufen.
In den 80-er Jahren entdeckten europäische Staaten den Handel und die Verschuldung als einen Hebel zur Schwächung des dortigen Systems, und begannen gerade zu Zeiten der Perestroika vermehrt in Geschäftsbeziehungen zu den sozialistischen Staaten zu treten.
Nach der Wende kam es zu einem unglaublichen Verfall der Produktion in Rußland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Die gesamten Lieferketten waren unterbrochen, die bisherige Finanzierung fiel weg. Der IWF nahm sich Rußlands an und verordnete weniger Geld-Drucken, um die Inflation klein zu halten. Massenentlassungen und Nicht-Zahlen von Gehältern ließen den inneren Markt zusammenbrechen. Und findige Ökonomen und aufsteigende Oligarchen entdeckten, daß ja die einheimischen Produkte sowieso nichts wert waren, predigten die Marktwirtschaft und erklärten, bevor die nicht Wurzeln geschlagen hätte, müßte man sowieso alles aus dem Goldenen Westen beziehen.
Mit Müh und Not gelang es Betriebsleitern, Lokalpolitikern, Geheimdienstlern und Militärs, wenigstens die Rüstungsindustrie halbwegs aufrechtzuerhalten, teilweise durch Schwarzhandel mit Waffen. Aber gerade die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie machte einen steilen Abstieg durch, der sich in den folgenden 2 Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen sehr unangenehm bemerkbar machte.
„Die Gas- und Ölkonzerne, die von den Sanktionen sehr betroffen waren, haben laut Industrieministerium zwischen 2015 und 2020 ihre Importe an Ausrüstung von 60 auf 43% reduziert. Diesen Sektor hatten die Strafmaßnamen vor allem im Auge, »um einen langfristigen wirtschaftlichen Druck auf das Land auszuüben«, wie in einem Gutachten des US-Kongresses vom Jänner 2020 betont wird.“
Die Idee der westlichen Regierungen war offensichtlich, durch Sanktionen Engpässe bei der Beschaffung von Ausrüstung für die Energie-Industrie zu erzeugen und damit eine wichtige Devisenquelle Rußlands zu beschädigen. Dergleichen ist bei Venezuela eine Zeitlang gelungen, aber Rußland hat doch andere industrielle und technische Ressourcen, die Maßnahme blieb allem Anschein nach völlig wirkungslos.
Die 43% Importe an Gerät für die Öl- und Gas-Industrie kamen also entweder durch Schmuggel oder durch Import aus befreundeten Staaten ins Land.
Man muß bei solchen Importbeschränkungen bedenken, daß die auch die Exporteure von dergleichen Technologie schädigen, die haben selber ein Interesse, ihr Zeug zu verkaufen, und sei es eben durch andere Kanäle.
„In anderen Fällen hat sich am Markt nichts geändert. Laut einer Studie der Wirtschaftshochschule Moskau machen die Importe an Konsumgütern 75% des Verbrauchs aus, nimmt man Kleidung und Spielzeug hinzu, sogar 90%.
»Bestimmte Importwaren zu ersetzen ist noch nicht per se Protektionismus. In den 70-er Jahren kauften Japan und Südkorea Lizenzen und Zusatzstoffe, um selbst die entsprechenden Produktionen anzuleiern, und sie waren damit erfolgreich«, führt der Professor dieser Wirtschaftshochschule Alexej Portanski ins Feld. Er war früher der Leiter der Behörde für den 2012 erfolgten WTO-Beitritt Rußlands. »Dergleichen will allerdings genau geplant werden, also in welchen Bereichen konkret etwas verändert werden soll, und innerhalb welcher Zeitspanne,« betont er.“
Japan und Südkorea waren allerdings damals Verbündete der USA, im Interesse des „Containments“ des sozialistischen Blocks (das war noch vor dem Bruch zwischen China und der SU) sollten diese Staaten gestärkt und zu Industrienationen aufgebaut werden. Heute würden Lizenzen und dergleichen nicht mehr so einfach an andere Staaten hinübergeschoben.
„Eines der Probleme bei der Steigerung der einheimischen Erzeugung ist, daß es dafür bedeutende Investitionen und auch Zeit braucht, um Wettbewerbsfähigkeit auf Exportmärkten zu erreichen, weil der innere Markt nicht groß genug ist, um die Kosten hereinzubringen.
Dazu gesellen sich die gestiegenen Kosten für den Import der Vorprodukte: Die russische Währung hat sich seit 2014 von 45 Rubel pro Euro auf 85 pro Euro entwertet.
»Die Importsubstitution ist ergebnislos geblieben. Es wird behauptet, sie hätte Erfolge verzeichnet, aber das stimmt nicht. Die Zahlen werden manipuliert,« behauptet Portanski,
um diese Behauptung gleich zu widerlegen:
„»Die russischen Lebensmittel haben ihren Anteil am Markt erhöht, das stimmt, aber betrachten wir sie vom Standpunkt des Konsumenten und der interessiert uns: Russische Produkte tauchten auf, aber sie sind teurer und die Qualität ist nicht sehr gut. Warum? Vorher hatten die Supermärkte ein größeres Angebot, jetzt sind unsere Produzenten die Monopolisten«, meint der Experte.“
Der Experte hat also doch nicht so sehr den Standpunkt der Konsumenten, sondern ein Lehrbuch der Marktwirtschaft vor Augen, wo der Wettbewerb die Qualität garantieren soll – wovon man hierzulande ein Lied singen kann: Hier bestimmt das Geldbörsel über die Qualität der Lebensmittel, wobei es verschiedene Marken von Bio- und verschiedene Marken von Junkfood gibt.
„Portanski bezieht sich auf eine Studie der Wirtschaftshochschule von 2019, die untersuchte, wie sich die Importsubstitution im Bereich der Lebensmittel in den ersten 5 Jahren ausgewirkt hatte. Außer den Kategorien Geflügel, Schweinefleisch und Tomaten, wo sich die Verbraucherpreise verringert hatten, waren sie in den restlichen Kategorien gestiegen.“
Das muß aber nicht an einer Verteuerung der einheimischen Lebensmittel liegen, sondern kann auch dadurch verursacht, daß von weiter weg importiert wurde, z.B. aus Brasilien. Die hier gelieferte Information beschränkt sich auf die Preise, die Herkunft und die Qualität bleiben im Dunkeln.
„Nach diesen Berechnungen haben sich die Kosten für Lebensmittel für die russischen Staatsbürger um 5,1 Milliarden Euros pro Jahr gegenüber 2013 verteuert.
Und das vor dem Coronavirus.
Mit der Pandemie und der globalen Unterbrechung von Lieferungen ist die Situation noch schlechter, weil laut (der Statistikbehörde) Rosstat haben sich die Lebensmittel im Vorjahr um 10,6% verteuert.“
Man fragt sich, woher dieses plötzliche Mitgefühl mit dem kleinen Mann von der Straße? – aus dem Munde von „Experten“, die sonst immer dafür sind, daß alle den Gürtel enger schnallen müssen, wenn die wirtschaftliche Vernunft das verlangt, wie z.B. in Griechenland, weil es überschuldet ist.
Außerdem mutet die ganze Argumentation seltsam an, weil aufgrund der Unterbrechung globaler Lieferketten hätte der Schaden noch größer ausfallen können, wenn die Auslandsabhängigkeit größer gewesen wäre.
Aber kommt schnell heraus, worum es dem Artikelschreiber und seinem Experten geht:
„»Die EU ist unser Haupt-Handelspartner und wir wollen diese Zusammenarbeit fortsetzen, weil mit den Investitionen von dort das Know-How ins Land kommt, das uns fehlt«, unterstreicht Potanski.“
Sanktionen und Hetze hin und her, wir wollen gut Freund bleiben mit dem Westen, damit er uns entwickelt! – dieses Credo der russischen westorientierten Ökonomen ist offenbar wasserdicht gegenüber den Feindschaftserklärungen, die seit Jahren aus westlichen Medien und von westlichen Politikern verlautbart werden.
Mit dieser Bewunderung der westlichen Expertise werden gleichzeitig die eigenen Schulen, Universitäten, Fabriken heruntergestuft und für mangelhaft erklärt, und die eigene Bevölkerung für zurückgeblieben. Es ist nicht notwendig, das ausdrücklich zu erwähnen – im Lob des westlichen Know-How ist diese Zurückstufung enthalten.
„Im offenen, mit Sanktionen ausgetragenen Konflikt beschuldigt Brüssel den Kreml, bei Ausschreibungen die eigenen Firmen gegenüber ausländischen zu bevorzugen“ –
unerhört! –
„und kündigte im November an, bei der WTO eine Beschwerde einzubringen, weil deren Grundprinzip heißt, daß ihre Mitglieder nicht aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt werden dürfen. Die Europäische Kommission betont, daß die wirtschaftlichen Folgen für ihre Unternehmen »sehr bedeutend« sind, da es bei den russischen Ausschreibungen jährlich um Millionen von Euros geht.“
Das schlägt dem Faß den Boden aus! Erst Sanktionen verhängen, damit die russische Wirtschaft geschädigt wird, und dann sich beschweren, daß die Gegenmaßnahmen der russischen Regierung die eigenen Unternehmen schädigen.
Man merkt daran, mit welcher Unverschämtheit sich die EU-Führung auf den Rest der Welt bezieht, der ihr anscheinend zu Füßen liegen müßte, und welchen Groll sie bei sich nährt, wenn sich eine Macht von den Dimensionen Rußlands diesem Anspruch verweigert.
„Brüssel beanstandet konkret drei Vorgaben des Kreml.
Erstens, die russischen Staatsbetriebe ziehen beim Preis, den die russischen Unternehmen anbieten, 30% ab. Zweitens, beim Import einiger Industriegüter ist für russische Firmen eine staatliche Genehmigung erforderlich. Und drittens, es gibt bei den Ausschreibungen Quoten für russische Produkte, die enthalten sein müssen, z.B. Fahrzeuge, medizinische Ausrüstung und Technologie.
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kommentierte die Forderungen Brüssels auf ihrem Telegram-Kanal: »Sie sind ein Unsinn, weil die Importsubstitution war eine Antwort auf die Sanktionen der EU gegen Rußland. Brüssel behauptete lange, daß unser Land ,hart bestraft’ worden sei. Hart daran ist nur der Sadomasochismus.«“
Die Dame verweist die EU-Kommission damit an das Salzamt, und die WTO-Beschwerdestelle ist ja auch ein solches.
„Ein Zeichen dafür, daß nicht alles läuft wie geplant, ist die Novellierung des Erlasses von 2014 vom vergangenen 24. Dezember“ (wie neckisch! Andere feiern Weihnachten, wir novellieren Dekrete) „bezüglich der Quoten für russische Produkte bei staatlichen Einkäufen. Von den in dieser Aufstellung gelisteten 100 Produkten werden 41 temporär entfernt, weil es keine passenden russischen Fabrikate gibt.“
Aber für 59 gibt es sie offenbar!
„Dazu gehören etwa medizinische Lampen, Laptops, Chipkarten, integrierte Schaltkreise und andere elektronische Teile.
Im Jänner 2014 plädierte der (2019 verstorbene) Ökonom Viktor Ivanter in einem Artikel in der offiziellen Rossijskaja Gazeta dafür, in die heimische Industrie zu investieren und auch der »besorgniserregenden Abhängigkeit« auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung ein Ende zu bereiten. »Nach Jahren der Reformen haben wir etwas erreicht, worauf wir nicht verzichten wollen: Der Konsument kann auswählen, aber diese Auswahl ist noch vom Import abhängig.«
8 Jahre später gibt es weniger Auswahl und alles kostet mehr.“
Man merkt, daß „der Kreml“ vielleicht noch nicht ganz dort ist, wo er hinkommen möchte, aber doch auf dem Weg dorthin, und wie sehr das westliche Medien stört.