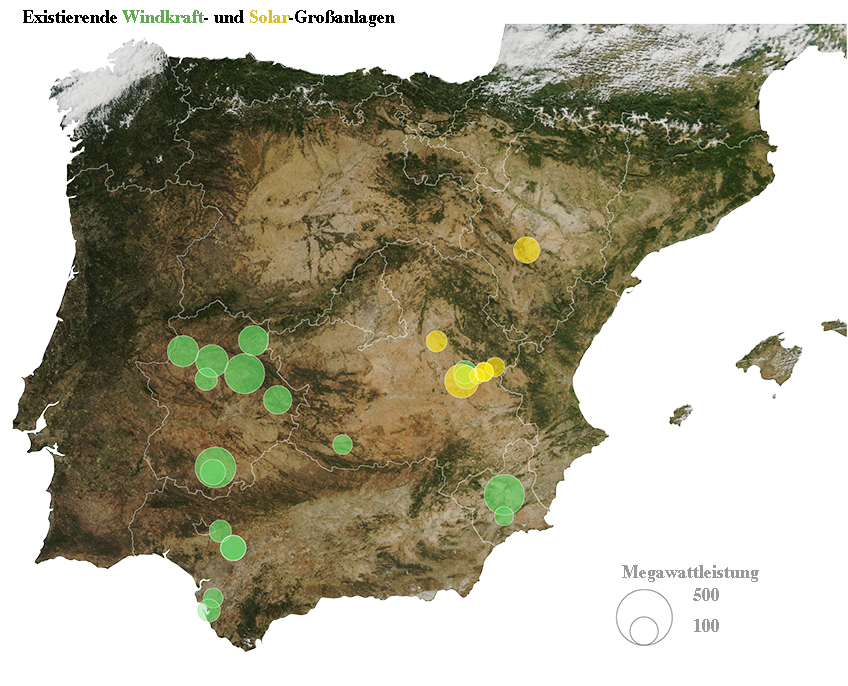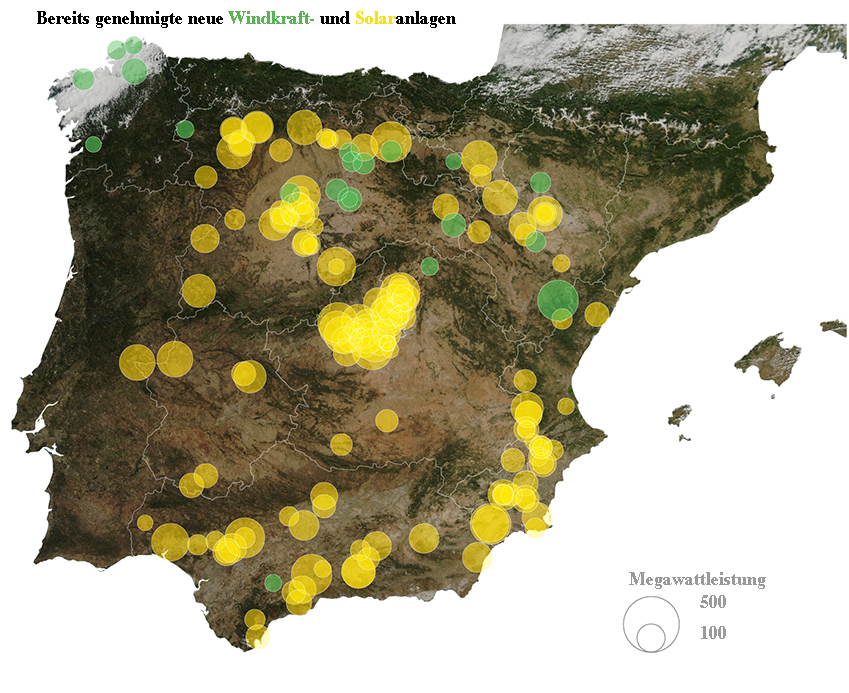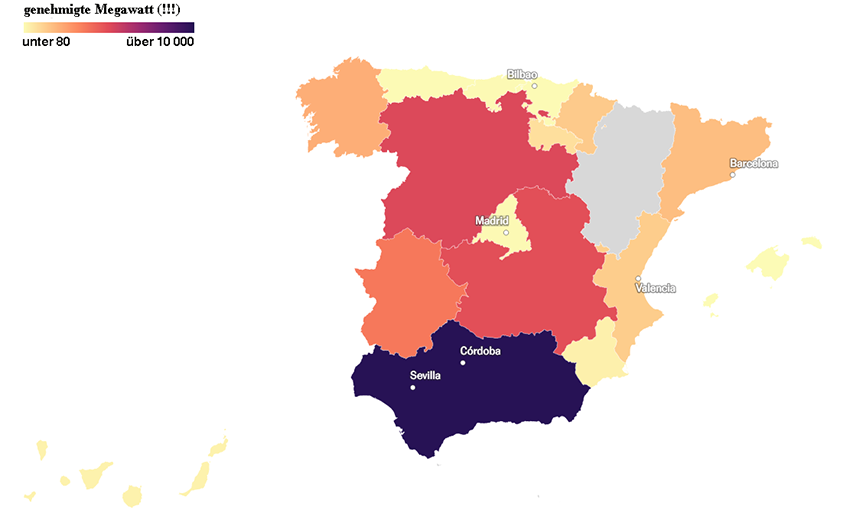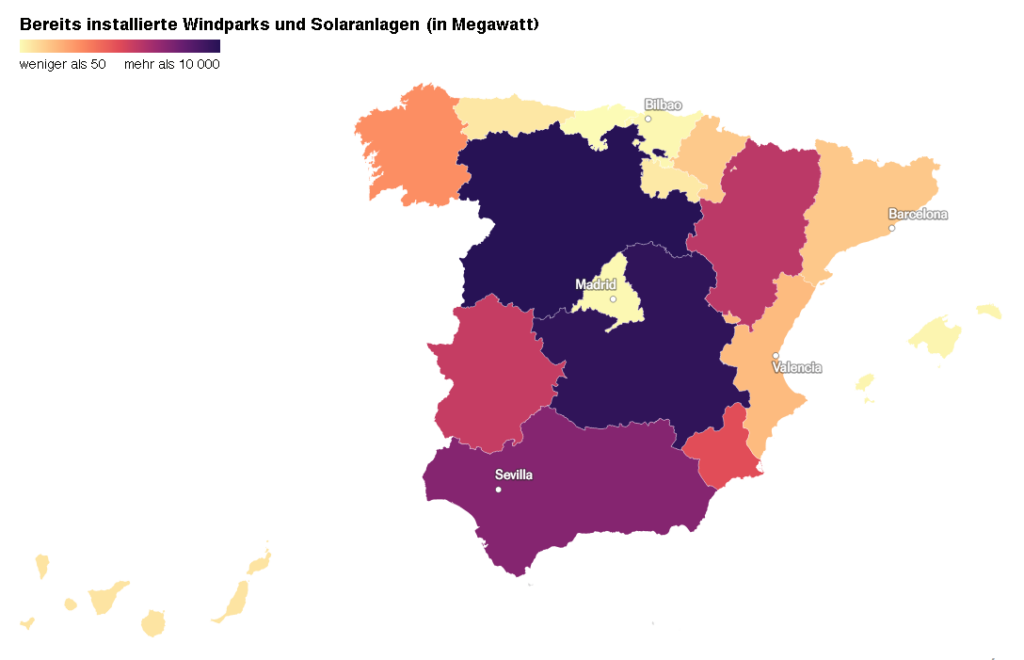DER TEUFELSKREIS DER SCHULDEN
Der Versuch, über die Schwelle zu schreiten und eine ordentliche Kapitalakkumulation hinzulegen, anstatt sich lediglich Rohstofflieferant für die Industrien der USA und der ehemaligen Kolonialmächte zu bleiben, zeichnet nicht nur Brasilien aus, sondern auch andere Staaten Lateinamerikas.
In Argentinien versuchte Perón eine eigene Industrie aufzubauen, in Mexiko verschiedene Präsidenten der Einheitspartei, die das Land bis 2000 regierte. Auch in Brasilien tat sich diesbezüglich einiges.
Der IWF und seine Schuldner
Neben dem Kapital, das nach 1945 in diese Richtung nördliche Vorbilder aufstrebenden Staaten wie Brasilien strömte – allerdings vor allem, um angesichts des eher schwachen inneren Marktes in Sparten zu investieren, die für den Export wichtig waren –, gesellten sich zunächst beim IWF und dann auch bei privaten Banken aufgenommene Kredite.
Die Verschuldung der Staaten Lateinamerikas, Afrikas und des fernen Ostens nahm Anfang der 70-er Jahre zu, als die Umstellung des IWF von der Goldbindung auf Sonderziehungsrechte die Kreditvergabe des IWF anspornte und die Banken der USA und vor allem Europas aus verschiedenen Gründen zuviel Geld hatten und nicht wußten, wohin damit. Da erschien u.a. Lateinamerika als perspektivenreicher Kunde.
Der IWF wurde mit der Zeit und den Schuldenproblemen als Gläubiger deshalb so wichtig für einen Kreditnehmer, weil der IWF-Kredit eine Art Bürgschaft darstellt: Wenn der IWF ein Land für kreditwürdig hält, so geben die kommerziellen Banken ihm auch Kredit. Wenn also ein Staat auf dem Finanzmarkt Geld aufnehmen will, so muß er sich erst beim IWF verschulden.
Das Geld, das mit dem IWF garantiert und von der kommerziellen Finanzwelt verliehen wird, ist Weltgeld und verschafft demjenigen, der den Kredit erhält, Zugriff auf Waren der ganzen Welt. Das heißt: sowohl auf Konsumgüter als auch auf Produktionsgüter wie Maschinen oder Industrieanlagen.
Außerdem ermöglicht ein IWF-Kredit das Anlegen bzw. die Pflege eines Devisen-, also Weltgeld-Schatzes, mit dessen Hilfe ein Staat die Konvertibilität seiner Währung garantieren kann. Das ist unbedingt notwendig, wenn dieser Staat bzw. seine Regierung ausländisches Kapital anziehen will. Mit der Konvertibilität kann er diesen Kapitalbesitzern garantieren, daß sie ihre Gewinne auch wieder in Weltgeld umwandeln und woanders hin verschieben können.
Der IWF war damals wichtig für Staaten, bei denen wenig Kapital akkumuliert worden war. Diejenigen Staaten, wo das Kapital sozusagen zu Hause ist, brauchten lange Zeit den IWF nicht als Kreditgeber – eher als Türöffner in andere Weltgegenden. Ihre Unternehmen exportierten selber genug Waren, um sich über den Welthandel die nötigen Devisen beschaffen zu können.
Diejenigen, die erst in diesen illustren Klub aufsteigen wollten, hatten vor, über Kredit eine Kapitalakkumulation in die Wege zu leiten. Sie waren von dem Willen getrieben, aus den Gewinnen der mit Kredit geschaffenen Unternehmen den Kredit zu bedienen bzw. auch irgendwann zu tilgen. Und das ist ja auch der Gedanke, der dem Begriff „Entwicklungsland“ zugrundeliegt. Hier geht es darum, den Weg der Entwicklung Richtung Westeuropa oder USA oder auch Australien zu beschreiten.
Wenn das nicht gelingt, so wächst die Verschuldung, und irgendwann einmal ist nicht genug da, um die regelmäßig fälligen Zinsen zu zahlen – geschweige denn, den Kredit zurückzuzahlen und sich damit aus dem Schuldendienst zu befreien.
Zu dieser mißlichen Lage tragen oftmals auch die Rohstoffpreise bei, die den Konjunkturen des Weltmarktes gemäß fallen oder ansteigen. Wenn sie fallen, so verringern sie damit die Einnahmen des Schuldnerstaates, der solche Rohstoffe oder Agrarprodukte liefert, und damit auch seine Fähigkeit zur Bedienung der Schulden – und erinnern ihn damit daran, daß er von seinen Plänen zur Erreichung eines kompletten Kapitalstandortes noch weit entfernt ist.
„Importsubstitution“
In der Literatur zu den Bemühungen der großen Staaten Lateinamerikas, sich in den Kreis derjenigen Nationen einzureihen, deren Währungen auch ohne die Hilfe des IWF konvertibel sind, weil sie auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen nachgefragt werden, wird diese Politik oftmals als das Streben nach „Importsubstitution“ bezeichnet.
Dieser Begriff hat von vornherein etwas Mißbilligendes an sich. Irgendetwas soll „ersetzt“ werden. Und dieses Irgendetwas, der Import, wird sozusagen als die natürliche, sozusagen prästabilisierte Harmonie aufgefaßt. Damit ist gesagt, daß diese Staaten eigentlich importieren sollen, damit die „entwickelten“ Staaten, die mit dem richtigen, dem Weltgeld, ihren Krempel irgendwohin verkaufen können. Wenn Deutschland – und inzwischen auch China – Exportweltmeister sind, so muß es ja auch Staaten geben, die Import-, hmmm, -Champions sind.
Eine Sache ist, Dinge zu produzieren oder nicht zu produzieren. Man denkt zunächst einmal an Konsumgüter. Wenn es keine Fabriken für Waschmaschinen oder Staubsauger gibt, so muß man diese Güter eben aus dem Ausland beziehen.
Das zweite ist aber die Zahlungsfähigkeit. Für diese ganzen Importe muß Weltgeld an Land gezogen werden, d.h., irgendetwas muß aus diesem Land auch hinausgehen. Und wenn ein Staat über wenig Bodenschätze verfügt, oder wenig fruchtbare Erde hat, – was die Handelsbilanz negativ beeinflußt – so bleiben noch Tourismus und Arbeitsemigration, um Devisen an Land zu ziehen.
Und wenn mit all diesen Wirtschaftszweigen immer zuwenig hereinkommt, so bleibt auch nur der Weg der Verschuldung – die sich in diesem Fall nicht aus Ambitionen Richtung wirtschaftliche Entwicklung ergibt, sondern aus einer negativen Zahlungsbilanz.
Diese negative Zahlungsbilanz zu überwinden, ist das, was mit gerunzelter Stirn als „Importsubstitution“ bezeichnet und auch oftmals als gescheiterte Wirtschaftspolitik verbucht wird, – mit dem Verweis auf Schuldenkrisen und natürlich die immer und überall vorhandene und daher auch problemlos als Ursache aller Übel verwertbare Korruption.
Vom IWF wurde daher seit dem Anfang der Schuldenkrisen in Lateinamerika immer wieder empfohlen, die eigene Bevölkerung zu verbilligen und sich im Sinne der „internationalen Arbeitsteilung“ wieder zum Exporteur von Agrarprodukten und Rohstoffen und zum Importeur von Konsumgütern herzurichten und sich in dieser Rolle zu bescheiden.
Die erste Schuldenkrise Brasiliens
„In den 1960er und 1970er Jahren hatten sich viele lateinamerikanische Staaten, insbesondere Brasilien, Argentinien und Mexiko, große Summen an Kapital von internationalen Gläubigern geliehen, um ihre Industrialisierung voranzubringen. … Zwischen 1975 und 1982 ist die Gesamtsumme der Forderungen kommerzieller Banken gegenüber Lateinamerika jährlich um 20,4 % gestiegen. Dieser Umstand führte zu einer Vervierfachung der lateinamerikanischen Auslandsschulden von 75 Milliarden US-Dollar (1975) auf mehr als 315 Milliarden US-Dollar im Jahr 1983, mithin 50% des Bruttoinlandsprodukts der gesamten Region. Der jährliche Schuldendienst (d. h. Tilgungs- und Zinszahlungen) stieg noch rasanter an und erreichte 1982 einen Betrag von 66 Mrd. US-Dollar (nach nur 12 Mrd. US-Dollar im Jahr 1975).
Als … der Ölpreis (in den 70-er Jahren) in die Höhe zu schießen begann, bedeutete dies für viele Länder der lateinamerikanischen Region einen Wendepunkt. Viele Entwicklungsländer befanden sich plötzlich in einem extremen Liquiditätsengpass, weil sie durch die steigenden Rohstoff-“ (will heißen: Energie-)„preise in Zahlungsnot gerieten. Erdölexportierende Länder wurden hingegen mit Finanzmitteln aufgrund der gestiegenen Erdölpreise überschwemmt und investierten das Geld bei internationalen Banken, die dieses wiederum in Form von Krediten in Lateinamerika anlegten (sogenanntes Petrodollar-Recycling). Dadurch akkumulierten sich die Auslandsschulden dieser Staaten über die Jahre gefährlich. Im Anschluss begann die Schuldenkrise, als die internationalen Kapitalmärkte gewahr wurden, dass Lateinamerika seine Schulden nicht mehr zurückzahlen können wird.“ (Wikipedia, Lateinamerikanische Schuldenkrise)
Dazu muß man erwähnen, daß die Rückzahlung von Schulden inzwischen mehr oder weniger als unschicklich betrachtet wird. Der Schuldner soll seine Schulden bedienen und daher den Banken als ständige und verläßlich sprudelnde Geldquelle dienen.
Bei Staaten als Schuldnern heißt das, daß an bestimmten Terminen umgeschuldet wird: Sie nehmen neue Kredite auf, mit denen sie ihre alten zurückzahlen. Formell ist somit die Altschuld getilgt. An diesen Terminen beweist der Staat, daß er über Kredit verfügt und daher des weiteren Kredites würdig ist.
„Dies geschah im August 1982, als Mexikos Finanzminister Jesus Silva-Herzog öffentlich bekannt gab, dass Mexiko seinen Schuldendienst einstellt und den teilweisen Staatsbankrott erklärte.“ (ebd.)
Brasilien geriet also gar nicht in erster Linie deshalb in die Schuldenkrise, weil sich Einnahmen und Ausgaben nicht mehr im vorgesehenen Rahmen hielten, sondern weil sich am Kreditmarkt Mißtrauen gegenüber den lateinamerikanischen Schuldnern breit machte und die Gläubiger Brasilien den Kredit abdrehten.
Wie sich später herausstellte, gab es aber noch andere Faktoren.
Aus dem Vertrag, den Brasilien 1983 mit dem IWF schloß, geht hervor, daß Brasilien mit seiner Industrialisierungspolitik relativ erfolgreich gewesen war. Von einem reinen Agrarexporteur hatte sich Brasilien in eine Ökonomie verwandelt, deren Export zu mehr als der Hälfte aus industriell hergestellten Waren bestand. Der Import bestand neben Produktionsgütern vor allem in Energieträgern, vor allem Erdöl. Und darin lag der eine Grund seiner Schuldenproblematik: Das Erdöl hatte sich sehr verteuert, dadurch flossen Devisen für Energie ab. Zweitens verteuerte sich der Kredit und damit stiegen auch die Schulden. Drittens fielen die Preise der Exportprodukte und sie trafen auf weniger Nachfrage aufgrund von Rezession in den Käuferländern. Das führte zu einem Kursverfall der brasilianischen Währung und zu galoppierender Inflation.
Im Gegenzug zu einem Stützungskredit in nicht genau festgelegter Höhe verpflichtete sich Brasilien, die Inflationsrate und das Budgetdefizit zu reduzieren. Die weiteren Punkte stellen eine Art Wunschzettel dar: Steigerung der Agrarproduktion zum Zwecke des Exports; Stimulierung der unternehmerischen Tätigkeit; maßvolle Lohnpolitik, um „den Arbeitsmarkt zu erweitern“, „Preise, die die Produktion stimulieren sollen“, und in Folge überhaupt eine Freigabe der Preise, also auch für bis zu diesem Zeitpunkt offenbar subventionierte Lebensmittel und Treibstoff. Gleichzeitig sollten die Steuern und Abgaben erhöht und dadurch die Staatseinnahmen erhöht werden.
Dieses und die folgenden Abkommen wurden nie erfüllt – all das konnte sich nicht ausgehen – und der Kredit floß stockend. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Probleme führten zum Ende der Militärregierung, und so – demokratisch und verschuldet – kam Brasilien in den globalisierten 90-er Jahren an.