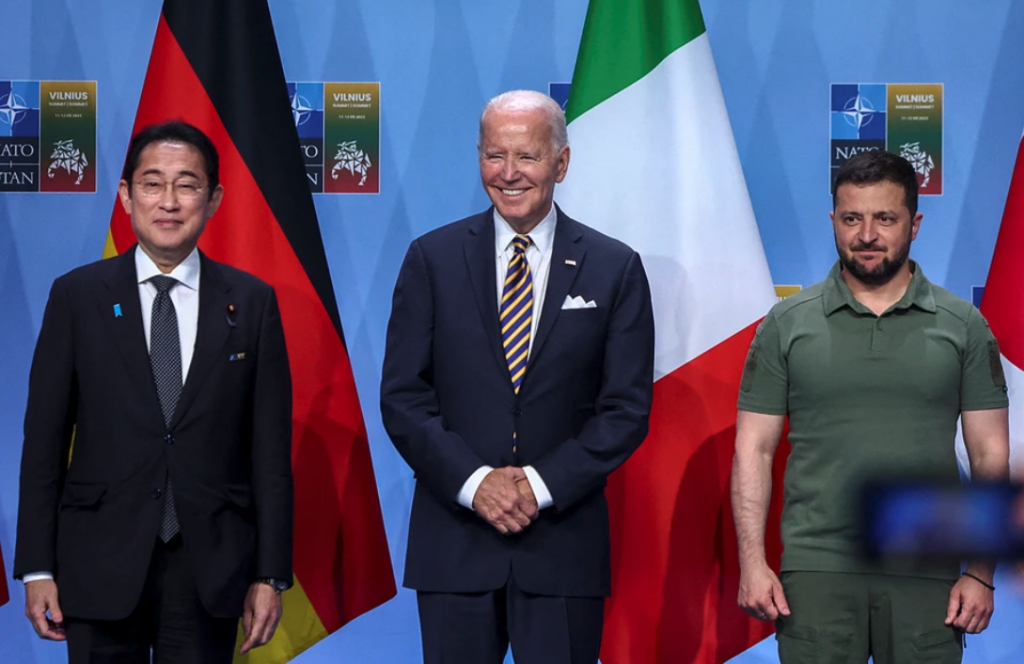„WARUM FINNLAND DIE NEUTRALITÄT DURCH DIE NATO-MITGLIEDSCHAFT ERSETZT
Die ersten wirtschaftlichen und politischen Folgen hat das Land bereits zu spüren bekommen
Seit Jahrzehnten trug der neutrale Status Finnlands in vielerlei Hinsicht zur Anerkennung des Landes auf dem internationalen Parkett bei und brachte dem Land gleichzeitig greifbare politische und wirtschaftliche Vorteile.
Im Jahr 2023 hat sich jedoch alles geändert, und Helsinki steht nun vor der Notwendigkeit, sich nicht nur an die neue Realität anzupassen, sondern auch die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und das angesichts ungewisser wirtschaftlicher Zukunftsperspektiven. Warum Finnland sich seiner privilegierten Stellung entzogen hat und wie viel es dafür bezahlen wird, untersucht die Izvestija.
Eine goldene Karte
Nach 4 umfassenden militärischen Konflikten mit der UdSSR in 25 Jahren (*1), in deren Folge die Idee von „Großfinnland“ begraben wurde, begann die politische Elite des Landes, nach und nach das Konzept der Neutralität zu entwickeln.
Darüber hinaus geschah dies in der Nachkriegszeit im Rahmen einer wirklich souveränen Außenpolitik, ungeachtet der Bemühungen des Westens, Nordeuropa in die NATO-Struktur zu integrieren. Der Beitritt Norwegens, Islands und Dänemarks zur NATO im Jahr 1949 beendete allerdings die Idee des Skandinavischen Verteidigungsbündnisses, einer Organisation, deren Gründung den neutralen Status der gesamten Region festigen hätte können.
Die Bemühungen der Regierungen Juho Kusti Paasikivi und Urho Kaleva Kekkonen trugen Früchte. Finnland blieb mehr als 70 Jahre lang nicht nur von den Hauptwidersprüchen des Kalten Krieges fern, sondern trug auch erfolgreich zu deren Lösung bei. Es war Kekkonens Initiative, die die Annahme der Schlussakte von Helsinki von 1975 beeinflusste, eigentlich eines gesamteuropäischen Nichtangriffspakts.“
Hier lernt man einmal die sowjetisch-russische Sichtweise dieser Schlußakte von Helsinki kennen, die in Moskau als Grundlage für umfassende Zusammenarbeit mit den westeuropäischen Staaten aufgefaßt wurde.
Hierzulande kennt man die diese Schlußakte nur als eine Art Menschenrechtserklärung, gegen die die Sowjetunion dauernd verstoßen hat, und als Berufungsinstanz von Dissidenten gegen das sowjetische „Regime“.
„Gleichzeitig baute Finnland unter Nutzung seines Status aktiv Wirtschaftsbeziehungen mit beiden Parteien“ (des Systemgegensatzes) „auf und schloss gleichzeitig zwei große Handelsabkommen ab – mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, dem Vorgänger der EU) und dem Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW).
Einerseits rettete dieses »Spiel auf zwei Brettern« Finnland weitgehend vor den Folgen der Wirtschaftskrise der 70er Jahre, andererseits schickte es Finnland durch den Verlust von Märkten infolge des Zusammenbruchs der UdSSR in die tiefste Rezession seiner Geschichte.
Nach 1991 änderte sich alles. Helsinki und Stockholm begannen sich nach und nach an Partnerschaftsprogrammen (»Partnership for Peace«) und NATO-Projekten zu beteiligen. Die erste Einladung zum Bündnis erhielt Finnland bereits 1994, am Vorabend des Budapester Gipfeltreffens der KSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa).
Damals verbarg in Washington und Brüssel niemand mehr seinen Appetit auf Nordeuropa. Später gab die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland zu, daß mindestens fünf US-Präsidentschaftsregierungen, in denen sie tätig war, also seit der Zeit von George Bush-Vater, ihre Bereitschaft zur Aufnahme Finnlands und Schwedens zum Ausdruck gebracht hätten.
Lange vor dem offiziellen Beitritt habe Finnland in allen möglichen Bereichen aktiv mit der NATO zusammengearbeitet, bemerkt Nikolai Mezhevitsch, Präsident der Russischen Vereinigung für Baltische Studien.
Finnische Diplomaten hörten irgendwann Mitte der 90er Jahre auf, das Wort »Neutralität« zu verwenden, sie sprachen lieber vom »blockfreien Status«, aber die Zusammenarbeit mit der NATO hatte bereits mit dem Rückzug Finnlands aus dem Pariser Friedensvertrag (1947) begonnen.
In der UdSSR nahm man an, daß Helsinki angesichts seiner historischen Erfahrungen niemals wagen würde, zum Feind zu werden. Darüber hinaus habe Finnland durch seine Präsenz im Wirtschaftsraum sowohl der UdSSR als auch Rußlands offensichtliche Vorteile erhalten, meint Mezhevitsch.
Nachdem die „goldene Generation“ finnischer Politiker in den Ruhestand ging, wurde sie durch Menschen ersetzt, an deren Kompetenz objektive Zweifel bestehen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den kürzlich bekannt gewordenen Tatsachen eines seltsamen, aber in gewisser Weise dem gleichen Stil verpflichteten Verhaltens von Mitgliedern der finnischen Regierung gewidmet werden.
Zunächst nahm der Minister für europäische Angelegenheiten und Vermögens-Steuerung,“
– ein eigenartiges Portfolio, das schon aussagt, daß man in Finnland nicht mehr jedes Eigentum respektieren will –
„Anders Adlercreutz, ein Video auf, in dem er auf dem Cello die Melodie des Liedes »Tschervona Kalina« (*2) spielt, der inoffiziellen Hymne der Kollaborateure der UPA.“
Das ist vielleicht etwas übertrieben, das Lied wurde vor dem I. Weltkrieg für ein Theaterstück verfaßt und war in der Ukraine sehr beliebt, nicht nur bei der UPA.
Der finnische Politiker wollte damit zweifelsohne seine Sympathie für die derzeitige ukrainische Führung ausdrücken.
„Dann wurde bekannt, dass die finnische Finanzministerin Riikka Purra unter einem Pseudonym rassistische Kommentare in sozialen Netzwerken verfaßte. Das Gesamtkunstwerk wurde durch den neuen Vorsitzenden der derzeit regierenden Sozialdemokratischen Partei, Antti Lindtman, vervollständigt, der auf kürzlich veröffentlichten Fotos nackt dargestellt ist, umgeben von Männern, die den Nazigruß praktizieren (und ebenfalls nackt sind).“
Man muß der Vollständigkeit halber erwähnen, daß es sich dabei um Jugendfotos handelt, die offenbar von Gegnern seiner Partei – oder innerhalb seiner Partei – in Umlauf gebracht wurden, um ihn im Inland zu diskreditieren.
„Die frühere Kabinettsvorsitzende Sanna Marin wurde auch durch ihre Teilnahme an der Beerdigung eines der Anführer des Rechten Sektors Kotsjubailo berühmt, der für Geschichten darüber bekannt ist, wie seine »Soldaten Hunde mit den Knochen russischer Kinder füttern«.
Die beruflichen und persönlichen Qualitäten der neuen finnischen Elite lassen viel zu wünschen übrig, bemerkt Nikolai Mezhevitsch.
Wir können getrost von der Degradierung der Eliten sprechen. Sie sind kompromittiert und daher einfacher zu lenken.“
Eine Charakterisierung, die nicht nur auf die finnische Politikermannschaft zutrifft.
Die heutigen Politiker, die außer Mode, Partys und ähnlichen Zerstreuungen nicht viel im Kopf haben, sind leicht zu steuern und ebenso leicht auszuwechseln, wenn sie es zu bunt treiben oder aus irgendwelchen anderen Gründen der Staatsräson im Wege stehen.
Man zieht einfach irgendein Skandälchen aus der Schublade – Drogen, Korruption, Neonazi-Verbindungen und ähnliches – und setzt sie unter Druck oder sägt sie ab.
Kurz oder Strache sind Beispiele dafür in Österreich.
„Man muß verstehen, dass unser Gegner nicht das finnische Volk ist, sondern seine Politiker, die mit erstaunlicher Beharrlichkeit die russisch-finnischen Beziehungen zerstören, sagt Mezhevitsch.
Ostsee und Arktis
Die Präsenz Finnlands in der NATO gewährleistet die Umsetzung zweier Strategien des Bündnisses, betreffend Ostsee und Arktis.
Im ersten Fall erfolgt die direkte Beteiligung Helsinkis eher in Worten als in Taten. Helsinki wird sich nun viel mehr um die Sicherung seiner 1.100 km langen Landgrenze zu Russland kümmern als darum, die Ostsee in ein »NATO-Binnenmeer« zu verwandeln.
Gleichzeitig beginnen in Finnland angesichts der starken Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen mit der Russischen Föderation Diskussionen über einen möglichen Rückzug aus dem Vertrag von 1940, in dem es unter anderem um den entmilitarisierten Status der Ålandinseln geht.
Die Einhaltung dieser Bedingung wird von der russischen diplomatischen Vertretung in Mariehamn kontrolliert. In einem aktuellen Interview schloss Präsident Sauli Niinistö eine Schließung dieser Vertretung nicht aus.
Was die Arktis betrifft, so verfügt Finnland hier tatsächlich sowohl über eine technologische Basis als auch über eine eigene (und sehr umfangreiche) Entwicklungsstrategie in der Region. Allerdings wird jede militärische Aktivität, einschließlich der Stationierung amerikanischer Militärstützpunkte auf seinem Territorium, von seinem östlichen Nachbarn eine angemessene Reaktion erhalten. Das wird für Finnland, das 70 Jahre lang keine Ahnung hatte, wie das Gleichgewicht der Bedrohungen tatsächlich aussieht, kaum als Errungenschaft im Bereich der nationalen Sicherheit angesehen werden können.
Der NATO-Beitritt wird eine umfassende Umstrukturierung der militärischen Kapazitäten mit sich bringen, betont Nikita Beluchin, Nachwuchsforscher in der Abteilung für europäische politische Studien am IMEMO RAN (Nationales Primakov-Forschungsinstitut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen).
»Das volle Ausmaß wird in ein paar Jahren klar sein, da alle nordischen Länder planen, die Verteidigungsausgaben in gewissem Umfang zu erhöhen. Auf der praktischen Seite wird der Rückkehr zu den Waffensystemen große Aufmerksamkeit gewidmet, die in den 90er und frühen 2000er Jahren aufgegeben wurden, als Auslandseinsätze Priorität hatten.
Darüber hinaus sprechen wir über Überwachungssysteme für die Aktionen der russischen Marine in der Ostsee«, sagte Beluchin.
Obwohl die Finnen die NATO-Mitgliedschaft befürworten, besteht hinsichtlich der Anwesenheit ausländischen Militärpersonals keine Einigkeit. Im Januar durchgeführte öffentliche Meinungsumfragen zeigten, dass nur 39 % der Befragten die Einrichtung eines dauerhaften NATO-Stützpunkts befürworten.
Der finnischen Gesellschaft wurde gesagt, dass sie für die neue Sicherheitsstruktur bezahlen würde, betont Nikolai Mezhevitsch.
»Nach den Informationen aus Finnland zu urteilen, können wir den Schluss ziehen, dass sie alle negativen Konsequenzen, die mit dem Abbruch der Beziehungen verbunden sind, bereits akzeptiert haben. Zuerst werden Energie und Tourismus einbrechen, dann andere Branchen«, glaubt Mezhevich. »Die Landwirtschaft konzentrierte sich hauptsächlich auf Rußland als Markt, da ihre Produkte für Europa zu teuer waren. Natürlich gibt es einen gewissen Spielraum aufgrund der hohen Qualität, aber dieser ist keineswegs unendlich.
Die finnische Gesellschaft war sich sicher, dass sie sich mit dem NATO-Beitritt auf die Seite der Gewinner stellte. Jetzt herrscht etwas Verwirrung.«
Reiner Selbstmord für Finnland
Die unglücklichste Auswirkung der Entscheidungen Helsinkis werden die wirtschaftlichen Folgen sein. Wie bereits erwähnt, wurde die UdSSR Mitte der 70er Jahre zum wichtigsten Handelspartner der Republik. Bis zu einem Viertel aller finnischen Exporte gingen in die Sowjetunion. Aber auch nach der tiefen Krise im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der UdSSR gelang es Finnland und Russland aus natürlichen Gründen bald, Handelsbeziehungen aufzubauen. Mitte der 2010er Jahre gehörte die Russische Föderation durchweg zu den Top 5 der finnischen Exporte und Importe, und Projekte in Branchen wie dem Schiffbau, dem Maschinenbau, der Metallverarbeitung und sogar der Nanoindustrie entwickelten sich aktiv.
Unterdessen entdeckte Sauli Niinistö am 7. Juli, dass der Versuch, Russland“ (als Handelspartner) „wirtschaftlich zu »stornieren«, ganz konkrete unangenehme Folgen hatte.
Absolut alle finnischen Unternehmen hätten den russischen Markt verlassen, aber das habe zu keinem Ergebnis geführt, sagte er.“
Eine rätselhafte Äußerung des finnischen Präsidenten. Er meint offenbar, zu keinem erwünschten Ergebnis betreffend die Schwächung Rußlands. Auf der finnischen Seite hatte es offenbar durchaus Resultate im Sinne eines wirtschaftlichen Einbruchs.
„»Wir sind eines der ganz wenigen Länder in dieser Situation. Leider scheint dieser Mechanismus unwirksam zu sein«, schloss Niinistö.“
Also der vollständige Rückzug aus den russischen Handelsbeziehungen hat in Rußland keine Auswirklungen. Aber in Finnland notgedrungen schon.
„Viel unangenehmer wird es sein zu erkennen, dass es in den kommenden Jahren nicht möglich sein wird, zum vorherigen Niveau der bilateralen Beziehungen, auch der wirtschaftlichen, zurückzukehren. Die Wirtschaft des Landes hat die negativen Auswirkungen politischer Entscheidungen bereits zu spüren bekommen. Laut Bloomberg geriet Finnland aufgrund der desaströsen Statistiken im vierten Quartal 2022 in eine Rezession, die vor allem auf einen starken Rückgang der Exporte zurückzuführen war.
Mit seiner Entscheidung hat Finnland tatsächlich ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen. Sollte es sich am Ende jedoch als Fehler herausstellen, wird es deutlich schwieriger, die Situation wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.“
_______________________________
(*1) Damit sind gemeint:
1. der finnische Bürgerkrieg vom 27. 1. bis 5. 5. 1918, der mit Hilfe Deutschlands zugunsten der herrschenden Klassen entschieden wurde,
2. der Karelische Aufstand vom 6.11. 1921 bis 21.3. 1922,
3. der „Winterkrieg“ vom 30.11. 1939 bis 13.3. 1940,
4. der „Fortsetzungskrieg“ vom 22.6. 1941 bis 19.9. 1944.
(*2) Der Titel bezeichnet den Strauch „Gemeiner Schneeball“, der sowohl in der Ukraine als auch in Rußland sehr häufig ist. Es ist ein während des 1. Weltkriegs und danach populär gewordenes Volkslied, das heute wieder sehr gerne als eine Art patriotische Hymne der Ukraine gesungen wird.
(Es gibt allerdings mehrere Lieder gleichen Namens auf Russisch, mit einem ganz anderen Text, und auch einen sowjetischen Film dieses Namens.)